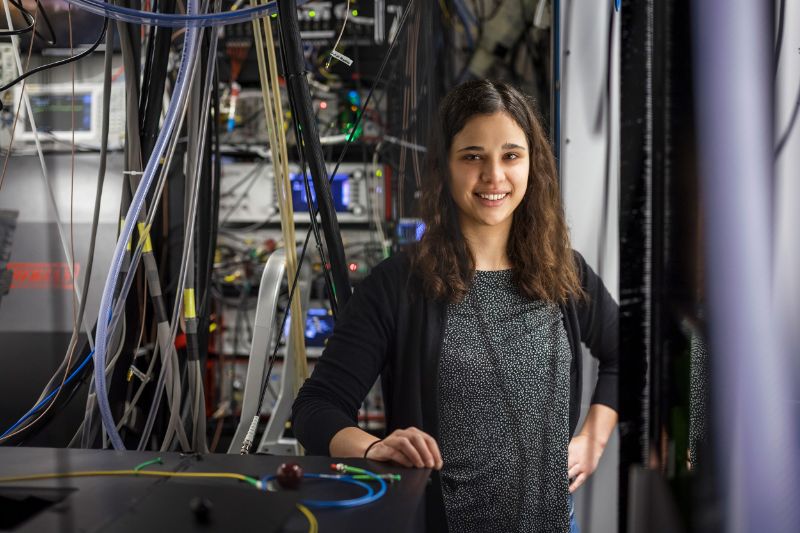Ein Studium für die Quantenzukunft
Vor hundert Jahren begann eine Reihe von weltbekannten Physikern wie Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born und Wolfgang Pauli damit, ihre Disziplin auf den Kopf zu stellen: Sie entwickelten die Grundlagen der Quantenmechanik. Eine Theorie, die sich grundlegend von der klassischen Physik unterscheidet und Konzepte verwendet, die für Laien nur schwer nachvollziehbar sind. Sie widerspricht sogar einigen Prinzipien, die in der klassischen Physik selbstverständlich sind.
«Ein Grossteil unseres modernen Verständnisses der Welt beruht auf Quantenmechanik», sagt Martin Frimmer, Professor für Photonik am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. «Die moderne Mikroelektronik zum Beispiel wäre undenkbar, wenn wir nicht verstünden, dass sich Elektronen in Halbleitern wie Wellen verhalten.» Einerseits sei die Quantenmechanik die Basis für konkrete Anwendungen, andererseits mache sie auch Voraussagen über Dinge, die in der Natur noch nie jemand beobachtet habe. Zum Beispiel zur Verschränkung von Quantenobjekten wie Elektronen, Photonen und Atomen oder zur Teleportation von Quanten.
Während Jahrzehnten waren dies reine Gedankenexperimente. Erst ab der Jahrtausendwende waren die Experimentatoren in den Labors so weit, dass sie diese Effekte auch routinemässig zeigen konnten. «Heute sind wir sogar so weit, dass wir sie auch technisch nutzen können – und dafür braucht es eine neue Klasse von Ingenieurinnen und Ingenieuren.» Diese zeichnen sich laut Frimmer durch zweierlei aus: Sie sind Cracks in den klassischen Ingenieurswissenschaften und gleichzeitig auf dem neusten Stand der Quantenwissenschaften.
Pionierin im Studiengang
Frimmer hat den zweijährigen Master of Science in Quantum Engineering mitentwickelt und ist heute der Programmleiter. Beim Start 2019 gehörte der Studiengang zu den ersten weltweit, die ein Ingenieursdiplom mit einer Spezialisierung in den Quantenwissenschaften verbanden. Der Master ist bei den Elektroingenieuren angesiedelt, wird aber gemeinsam mit dem Departement Physik organisiert. Studierende können aus dem Kurskatalog der beiden Departemente frei Vorlesungen auswählen und so ihren Präferenzen folgen.
Ein Fokus liegt von Beginn an auf Praxis und Anwendungen: Bereits im zweiten Semester arbeiten die Studierenden an einem mehrwöchigen Semesterprojekt. Dieses kann in einer Forschungsgruppe der ETH Zürich, einer anderen Hochschule oder bei einem Industriepartner erfolgen. Im zweiten Jahr entwickeln die Studierenden in Vierergruppen bereits erste Quantenanwendungen in einem ETH-Labor oder bei Industriepartnern. Heute beginnen jährlich gut dreissig Studierende, wobei der Frauenanteil zwischen zwanzig und dreissig Prozent liegt.
Sophie Cavallini ist eine von ihnen. Sie hat ursprünglich Physik und Ingenieurwesen in Mailand studiert und den Master an der ETH letztes Jahr abgeschlossen. «Was mir gefiel, war die Praxisnähe, das kenne ich so aus Italien nicht», sagt sie. «Die Projektarbeiten waren sehr ambitioniert und teils auch etwas futuristisch.» Sie hat den praktischen Teil in der Gruppe von Jonathan Home am Departement Physik absolviert.
Nach Abschluss begann sie dort gleich ein Doktorat. «Wir fangen Ionen mit elektromagnetischen Feldern und schiessen mit Lasern auf sie, um ihren Energiezustand zu ändern», fasst sie ihre Arbeit zusammen. Längerfristiges Ziel sei die Entwicklung von integrierten photonischen Chips, die mit Licht anstelle von elektrischem Strom funktionieren. «Wir arbeiten an einer Technologie, die nicht nur für Quantencomputing zentral ist, sondern zum Beispiel auch für eine neue Generation von Biosensoren eingesetzt werden könnte.»
Die heute 24-Jährige hat sich während des Studiums stark in der Quantum Engineering Commission engagiert. Der Studierendenverband organisiert Barbecues im Sommer, Fondues in der Weihnachtszeit, einen wöchentlichen Journal Club, bei dem Gäste ihre neusten Forschungsarbeiten präsentieren, Austausche mit anderen Universitäten und Unternehmensbesuche. «Ich hatte nicht erwartet, dass wir unter den Studierenden dermassen viel Spass haben würden», erinnert sich Cavallini.
Sie hat unter anderem zwei Quanten-Hackathons auf dem Hönggerberg mitorganisiert. Hundert Studierende aus ganz Europa nahmen teil und «hackten» 48 Stunden lang, um eine bestimmte Quantum-Engineering-Aufgabe zu lösen. Dabei wurden sie von Tutorinnen und Tutoren aus Industrie und Forschung begleitet. «Das Grossartige ist, dass man Freundschaften schliesst und Studierende von anderen Unis kennenlernt», sagt die Doktorandin. «Manche sieht man später wieder auf Konferenzen oder bei Weiterbildungen im Ausland.» Und weil der Anlass von Industriepartnern mitgetragen werde, sei der Hackathon auch eine niederschwellige Gelegenheit, um mit zukünftigen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen.
Von Island an die ETH
Björn Josteinsson gehört zu den ersten Studienabgängern. Seit 2022 arbeitet er bei QZabre, einem ETH-Spin-off, das Quantenmikroskope entwickelt. Anhand von Stickstoff-Fehlstellen in Diamanten misst das Unternehmen magnetische und elektrische Felder, Stromdichten und Temperaturen auf einer Skala von Nanometern. «Ich kann an vorderster Front an bahnbrechenden Technologien mitarbeiten», sagt Josteinsson. «Wir entwickeln Messtechniken, die komplett neue Möglichkeiten eröffnen.»
Josteinsson ist in Island aufgewachsen, hat dort Physik studiert und kam im Bachelorstudium erstmals mit der Quantenmechanik in Kontakt. «Ich wollte einerseits tiefer in die Quantentheorie eintauchen, sie aber gleichzeitig auch praktisch anwenden», erzählt er. Einen entsprechenden Studiengang gab es in Island nicht; er fand ihn in Zürich. Während des Studiums habe er sich oft gefühlt, als sei er in einem Geschäft voller Schleckwaren gelandet.
«An der ETH gibt es so viele Labors, in denen an interessanten Quantenexperimenten gearbeitet wird. Und wir durften praktisch überall mitarbeiten. Das war fantastisch.» Den Kontakt zu QZabre hat der heute 28-Jährige während seines Praktikums im Studium etabliert. Mittlerweile sei ein weiterer Studienabgänger angestellt worden; zudem kämen die meisten Praktikantinnen und Praktikanten vom Quantenstudiengang der ETH Zürich.
Laut Frimmer bietet der Masterstudiengang heute beste Berufschancen. «Es gibt praktisch keinen grossen Technologiekonzern mehr, der nicht an Quantenanwendungen forscht.» Google, Microsoft, Amazon, aber auch die Chemie- und Pharmaindustrie – sie alle hätten heute eigene Teams auf dem Gebiet. Obschon es erst wenige Produkte gebe, die auf Quantenengineering beruhten und auch der Quantencomputer noch auf sich warten liesse, werde das Interesse aus der Industrie immer grösser, sagt Frimmer.
Internationaler Hub
«Wir haben bei der Studiengangentwicklung bald gemerkt, dass wir nicht alles selbst machen müssen, sondern auf Unterstützung aus der Praxis zählen können.» Viele Lern- und Projektveranstaltungen finden mittlerweile in enger Kooperation mit Industriepartnern statt. «Zürich ist heute ein internationaler Quantum Hub, mit grossen Konzernen und kleinen Start-ups.»
Seit drei Jahren beobachte Frimmer, dass Studienabgängerinnen und -abgänger zunehmend direkt in die Industrie gingen und nicht mehr automatisch ein Doktorat beginnen würden. Das bestätige: «Die Quantenmechanik ist längst nicht mehr nur reine Grundlagenforschung, sondern eine echte Ingenieursdisziplin geworden.» Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und ihre Physikerkollegen hätten darüber wohl nicht schlecht gestaunt.
Neues Physikgebäude
Auf dem Campus Hönggerberg entsteht derzeit ein zukunftsweisender Neubau. Auf einem Drittel oberirdischer und zwei Dritteln unterirdischer Fläche entstehen Büro- und Lehrräume sowie auf über 5400 m2 hochsensible Labore für rund 500 Forschende und Studierende. In den Hochleistungslaboren werden für Physikexperimente ohne jegliche Umwelteinflüsse hochempfindliche Forschungsinfrastrukturen eingerichtet. Temperaturabweichungen dürfen nicht grösser als 0,01 Grad Celsius sein, die Luftfeuchtigkeit muss konstant sein und Vibrationen sollten unter 0,1 Mikrometer pro Sekunde liegen. Mit dem Neubau will die ETH Zürich ihre Stellung in den Quantentechnologien weiter ausbauen. Ermöglicht wird der Bau durch eine Donation des ETH-Alumnus und -Ehrenrats Martin Haefner.