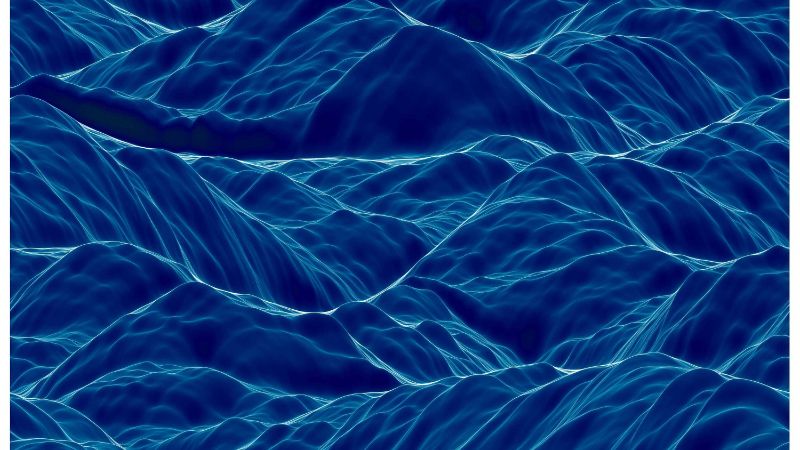Faszination Bild
Welche Rolle spielt «Schönheit» in der Wissenschaftskommunikation mit Bildern? Die beiden Wissenschaftler:innen und Bildexpert:innen, denen diese Frage gestellt wird, mögen den Begriff nicht sehr. Sarine Waltenspül und ihr Forschungspartner Mario Schulze sprechen lieber vom «Begehren nach Bildern» oder allgemeiner von «Ästhetik». «‹Schönheit› kommt leicht wie eine universalistische Kategorie daher», erläutern sie. «Bilder werden aber in verschiedenen Kontexten produziert und von unterschiedlichen Publika wahrgenommen und interpretiert.» Deshalb sei die Frage, wer wann auf was schaut, entscheidend.
Genau dieser Frage gehen die beiden am Beispiel eines Films aus der Fluiddynamik nach. Ihr Projekt «Film, Forschung, Fluidität» führen sie als Fellows am Collegium Helveticum durch, einer Institution von ETH, Universität Zürich und ZHdK, die die Begegnung zwischen den Disziplinen unterstützt. Im Projekt geht es um die erkenntnistheoretischen Implikationen, Ästhetiken und Politiken von Bewegtbildern in den Wissenschaften. Ausgangspunkt ist der 1927 entstandene Film «Entstehung von Wirbeln bei in Wasser bewegten Körpern» von Ludwig Prandtl, einem deutschen Wissenschaftler, der Beiträge zum grundlegenden Verständnis der Strömungsmechanik entwickelte.
Vom Hörsaal zum Filmfestival
«Er nutzte die Möglichkeiten von Bild und Bewegtbild, um Phänomene zu veranschaulichen, die sich aus dem damaligen mathematischen Modell für Strömungen noch nicht ableiten liessen», erzählt Schulze. «Aber auch, um seine Lectures attraktiver zu gestalten.» Und das mit grossem Erfolg. Prandtl zeigte seinen Film auf Konferenzen rund um die Welt. Und dabei blieb es nicht. Der Film wird im Nationalsozialismus umgearbeitet zu einem Hochschul-Unterrichtsfilm und gelangt während des Kalten Kriegs sogar in die Schulzimmer. Als Prandtls Film schliesslich in den 2000er-Jahren in Filmprogrammen zu Experimentalfilm und visueller Musik gezeigt wird, hat er den wissenschaftlichen Rahmen endgültig verlassen. «In der Rezeption des Films lässt sich neben dem Aspekt des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns immer wieder auch das Moment der puren Faszination und Attraktion durch diese filmischen Bilder ausmachen», sagt Waltenspül.
Prandtls Film zeichnet sich durch eine eigene Ästhetik aus. In grösstmöglichem Hell-Dunkel-Kontrast strömen glitzernde Partikel vor schwarzem Hintergrund um einfache geometrische Körper wie Zylinder oder Pyramiden. «Diese Bilder sind sehr abstrakt, sehr klar, aber sie haben auch etwas Rhythmisches, fast Musikalisches», sagt sie. «Sie sind präzise, oft im goldenen Schnitt und entsprechen damit gewissen Schönheitsidealen.» Der hohe Abstraktionsgrad sei einerseits Ausdruck des Bemühens um wissenschaftliche Objektivität, fügt Schulze an. Andererseits habe dieser auch begünstigt, dass der Film in unterschiedlichen Zusammenhängen anschlussfähig gewesen sei.
So entsprach die sachliche Ästhetik von Prandtls Filmbildern den wissenschaftlichen Erwartungen seiner Zeit. Das Aufkommen der Bildtechniken Fotografie und Film ging mit einer sich wandelnden Definition von wissenschaftlicher Objektivität einher, erläutert Schulze in Anlehnung an die Wissenschaftshistoriker:innen Lorraine Daston und Peter Galison. Frühere wissenschaftliche Darstellungen wie Zeichnungen und Stiche sollten die Naturwahrheit auch im Sinn von Naturschönheit wiedergeben, wobei Schönheit und Wahrheit zusammenfielen. Zeichner oder Graveure liessen ihre ästhetisch-künstlerische Sicht miteinfliessen. In Fotografie und Film sah man dann eine naturgetreue Wiedergabemöglichkeit, eine quasi mechanische Objektivität. «Die Frage nach dem Einfluss der Technologien und Apparate auf das wissenschaftliche Denken stellt sich auch in der Bildproduktion, aktuell natürlich auch in Hinblick auf die virtuellen Bildwelten», ergänzt Waltenspül.
Mit dem Aufkommen neuer Bildtechnologien vervielfältigten sich zudem die Möglichkeiten, Wissenschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. «Kommunikation mit Bildern funktioniert direkter als die Kommunikation über Worte», sagt Schulze. Bilder gehören deshalb zum Grundrepertoire der Wissenschaftspopularisierung. Aufmerksamkeit wird in diesem Zusammenhang vermehrt mittels ästhetischer Strategien wie Attraktion, Schönheit, Neuigkeit und Überraschung generiert.
Vor diesem Hintergrund verwundere es nicht, dass Wissenschaftsorganisationen wie beispielsweise der Schweizerische Nationalfonds oder die deutsche Max-Planck-Gesellschaft Wettbewerbe für die besten Wissenschaftsbilder durchführen und diese auch in Museen ausstellen. Neu sei die Popularisierung von Wissenschaft mithilfe von Bildern nicht, sagt Waltenspül, aber sie nehme immer stärker zu. «Wissenschaftler:innen sind heute mehr denn je darauf angewiesen, zu kommunizieren und Aufmerksamkeit zu gewinnen – innerhalb ihrer Disziplinen, über Disziplinengrenzen hinweg und in der breiten Öffentlichkeit.» Wie nützlich dazu Bilder sind, wusste bereits Ludwig Prandtl.